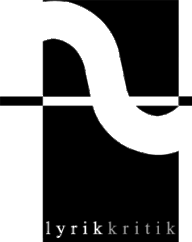Kraus-Adorno-Schlotmann
„Die Sensibilität des Schriftstellers in der Interpunktion bewährt sich in der Behandlung der Parenthesen. Der Vorsichtige wird dazu neigen, sie zwischen Gedankenstriche zu stellen und nicht in Klammern, denn die Klammer nimmt die Parenthese aus dem Satz ganz heraus, schafft gleichsam Enklaven, während doch nichts, was in guter Prosa vorkommt, dem Gesamtbau entbehrlich sein sollte; mit dem Zugeständnis solcher Entbehrlichkeit geben die Klammern stillschweigend den Anspruch auf die Integrität der sprachlichen Gestalt auf und kapitulieren vor der pedantischen Banausie. Dagegen halten die Gedankenstriche, welche die Parenthese aus dem Fluß herausstauen, ohne sie ins Gefängnis zu sperren, Beziehung und Distanz gleichermaßen fest.“ (Adorno, „Satzzeichen“, in „Noten zur Literatur“ SV, 1974, S.111)
Das Zitat aus Adornos Aufsatz soll hier nicht zur naiven kritischen Anwendung auf „Die Freuden der Jagd“ herausgestellt sein, denn um sich klar zu machen, daß Schlotmann Satzzeichen zu etwas anderem verwendet, als Adorno vorschwebt, genügt ein Blick in das Buch. Nicht aus dem Blick zu verlieren ist, dass das „Heute“ von dem aus der anweisungsfreudige Adorno spricht, heute auch - unter gewissen Umständen - historisch verstanden werden kann. „Jedenfalls wird heute wohl der am besten fahren, der an die Regel: besser zuwenig als zuviel, sich hält.“ Und Kritik soll ja von den immanenten Kriterien des Kritisierten ausgehen. (Adorno selbst macht ein paar Zeilen weiter gleich eine Ausnahme: „Proust, den keiner leicht einen Banausen nennen wird und dessen Pedanterie nichts ist als ein Aspekt seiner großartigen mikrologischen Kraft ...)“ „Die letzten Tage der Menschheit“ sind auch „Die letzten Tage der Sprache“. Es wäre auf jeden Fall lächerlich, die Stoßrichtung und Darstellungsweise des Gesamtgefüges zu ignorieren und die Ausdrucksweisen der krausschen Protagonisten zu kritisieren. Als erstes könnte (versuchsweise) festgestellt werden: Sprachverhalten und Redensarten, wie sie in „Die Freuden der Jagd“ durchdekliniert und bloßgestellt werden - daß sie Haltungen wiederspiegeln, versteht sich, wurde aber im Vorfeld naiv vereinfacht-, verdienen nicht den Umgang mit Satzzeichen, um den es Adorno in seinem Aufsatz geht. ,Wie man mit dem Hammer literarisch vorgeht‘, sei in diesen Zusammenhängen viel eher angebracht. Ich will aber den Aufsatz als einen der Hintergründe heranziehen (und damit gleich zu seiner Lektüre einladen), von dem aus eine Perspektive auf das Buch Schlotmanns und seine Eigenheiten gewonnen werden kann. Zu den Provokationen dieses Buches scheint es auf jeden Fall zu gehören, mit den Satzzeichen zu beginnen. "Denn die Anforderungen der Regeln der Interpunktion und des subjektiven Bedürfnisses von Logik und Ausdruck lassen sich nicht vereinen: in den Satzzeichen geht der Wechsel, den der Schreibende auf die Sprache zieht, zu Protest. Weder kann er den vielfach starren und groben Regeln sich anvertrauen, noch kann er sie ignorieren, wenn er nicht einer Art Eigenkleidung verfallen und durch die Pointierung des Unscheinbaren - und Unscheinbarkeit ist das Lebenselement der Interpunktion - deren Wesen verletzen will." Hier läßt sich im Sinne einer Dialektik schon ahnen, daß es auch eine komplementäre Verhaltensweise geben kann, die den Gegenständen, die sie aufs Korn nimmt, gerecht wird, und sei es, daß die Verletzungen, um die es geht, sich im Satzbau und Textgefüge widerspiegeln.
Das Zitat aus Adornos Aufsatz soll hier nicht zur naiven kritischen Anwendung auf „Die Freuden der Jagd“ herausgestellt sein, denn um sich klar zu machen, daß Schlotmann Satzzeichen zu etwas anderem verwendet, als Adorno vorschwebt, genügt ein Blick in das Buch. Nicht aus dem Blick zu verlieren ist, dass das „Heute“ von dem aus der anweisungsfreudige Adorno spricht, heute auch - unter gewissen Umständen - historisch verstanden werden kann. „Jedenfalls wird heute wohl der am besten fahren, der an die Regel: besser zuwenig als zuviel, sich hält.“ Und Kritik soll ja von den immanenten Kriterien des Kritisierten ausgehen. (Adorno selbst macht ein paar Zeilen weiter gleich eine Ausnahme: „Proust, den keiner leicht einen Banausen nennen wird und dessen Pedanterie nichts ist als ein Aspekt seiner großartigen mikrologischen Kraft ...)“ „Die letzten Tage der Menschheit“ sind auch „Die letzten Tage der Sprache“. Es wäre auf jeden Fall lächerlich, die Stoßrichtung und Darstellungsweise des Gesamtgefüges zu ignorieren und die Ausdrucksweisen der krausschen Protagonisten zu kritisieren. Als erstes könnte (versuchsweise) festgestellt werden: Sprachverhalten und Redensarten, wie sie in „Die Freuden der Jagd“ durchdekliniert und bloßgestellt werden - daß sie Haltungen wiederspiegeln, versteht sich, wurde aber im Vorfeld naiv vereinfacht-, verdienen nicht den Umgang mit Satzzeichen, um den es Adorno in seinem Aufsatz geht. ,Wie man mit dem Hammer literarisch vorgeht‘, sei in diesen Zusammenhängen viel eher angebracht. Ich will aber den Aufsatz als einen der Hintergründe heranziehen (und damit gleich zu seiner Lektüre einladen), von dem aus eine Perspektive auf das Buch Schlotmanns und seine Eigenheiten gewonnen werden kann. Zu den Provokationen dieses Buches scheint es auf jeden Fall zu gehören, mit den Satzzeichen zu beginnen. "Denn die Anforderungen der Regeln der Interpunktion und des subjektiven Bedürfnisses von Logik und Ausdruck lassen sich nicht vereinen: in den Satzzeichen geht der Wechsel, den der Schreibende auf die Sprache zieht, zu Protest. Weder kann er den vielfach starren und groben Regeln sich anvertrauen, noch kann er sie ignorieren, wenn er nicht einer Art Eigenkleidung verfallen und durch die Pointierung des Unscheinbaren - und Unscheinbarkeit ist das Lebenselement der Interpunktion - deren Wesen verletzen will." Hier läßt sich im Sinne einer Dialektik schon ahnen, daß es auch eine komplementäre Verhaltensweise geben kann, die den Gegenständen, die sie aufs Korn nimmt, gerecht wird, und sei es, daß die Verletzungen, um die es geht, sich im Satzbau und Textgefüge widerspiegeln.
lewi - 13. Okt, 12:48