Kraus-Adorno-Schlotmann
„Die Sensibilität des Schriftstellers in der Interpunktion bewährt sich in der Behandlung der Parenthesen. Der Vorsichtige wird dazu neigen, sie zwischen Gedankenstriche zu stellen und nicht in Klammern, denn die Klammer nimmt die Parenthese aus dem Satz ganz heraus, schafft gleichsam Enklaven, während doch nichts, was in guter Prosa vorkommt, dem Gesamtbau entbehrlich sein sollte; mit dem Zugeständnis solcher Entbehrlichkeit geben die Klammern stillschweigend den Anspruch auf die Integrität der sprachlichen Gestalt auf und kapitulieren vor der pedantischen Banausie. Dagegen halten die Gedankenstriche, welche die Parenthese aus dem Fluß herausstauen, ohne sie ins Gefängnis zu sperren, Beziehung und Distanz gleichermaßen fest.“ (Adorno, „Satzzeichen“, in „Noten zur Literatur“ SV, 1974, S.111)
Das Zitat aus Adornos Aufsatz soll hier nicht zur naiven kritischen Anwendung auf „Die Freuden der Jagd“ herausgestellt sein, denn um sich klar zu machen, daß Schlotmann Satzzeichen zu etwas anderem verwendet, als Adorno vorschwebt, genügt ein Blick in das Buch. Nicht aus dem Blick zu verlieren ist, dass das „Heute“ von dem aus der anweisungsfreudige Adorno spricht, heute auch - unter gewissen Umständen - historisch verstanden werden kann. „Jedenfalls wird heute wohl der am besten fahren, der an die Regel: besser zuwenig als zuviel, sich hält.“ Und Kritik soll ja von den immanenten Kriterien des Kritisierten ausgehen. (Adorno selbst macht ein paar Zeilen weiter gleich eine Ausnahme: „Proust, den keiner leicht einen Banausen nennen wird und dessen Pedanterie nichts ist als ein Aspekt seiner großartigen mikrologischen Kraft ...)“ „Die letzten Tage der Menschheit“ sind auch „Die letzten Tage der Sprache“. Es wäre auf jeden Fall lächerlich, die Stoßrichtung und Darstellungsweise des Gesamtgefüges zu ignorieren und die Ausdrucksweisen der krausschen Protagonisten zu kritisieren. Als erstes könnte (versuchsweise) festgestellt werden: Sprachverhalten und Redensarten, wie sie in „Die Freuden der Jagd“ durchdekliniert und bloßgestellt werden - daß sie Haltungen wiederspiegeln, versteht sich, wurde aber im Vorfeld naiv vereinfacht-, verdienen nicht den Umgang mit Satzzeichen, um den es Adorno in seinem Aufsatz geht. ,Wie man mit dem Hammer literarisch vorgeht‘, sei in diesen Zusammenhängen viel eher angebracht. Ich will aber den Aufsatz als einen der Hintergründe heranziehen (und damit gleich zu seiner Lektüre einladen), von dem aus eine Perspektive auf das Buch Schlotmanns und seine Eigenheiten gewonnen werden kann. Zu den Provokationen dieses Buches scheint es auf jeden Fall zu gehören, mit den Satzzeichen zu beginnen. "Denn die Anforderungen der Regeln der Interpunktion und des subjektiven Bedürfnisses von Logik und Ausdruck lassen sich nicht vereinen: in den Satzzeichen geht der Wechsel, den der Schreibende auf die Sprache zieht, zu Protest. Weder kann er den vielfach starren und groben Regeln sich anvertrauen, noch kann er sie ignorieren, wenn er nicht einer Art Eigenkleidung verfallen und durch die Pointierung des Unscheinbaren - und Unscheinbarkeit ist das Lebenselement der Interpunktion - deren Wesen verletzen will." Hier läßt sich im Sinne einer Dialektik schon ahnen, daß es auch eine komplementäre Verhaltensweise geben kann, die den Gegenständen, die sie aufs Korn nimmt, gerecht wird, und sei es, daß die Verletzungen, um die es geht, sich im Satzbau und Textgefüge widerspiegeln.
Das Zitat aus Adornos Aufsatz soll hier nicht zur naiven kritischen Anwendung auf „Die Freuden der Jagd“ herausgestellt sein, denn um sich klar zu machen, daß Schlotmann Satzzeichen zu etwas anderem verwendet, als Adorno vorschwebt, genügt ein Blick in das Buch. Nicht aus dem Blick zu verlieren ist, dass das „Heute“ von dem aus der anweisungsfreudige Adorno spricht, heute auch - unter gewissen Umständen - historisch verstanden werden kann. „Jedenfalls wird heute wohl der am besten fahren, der an die Regel: besser zuwenig als zuviel, sich hält.“ Und Kritik soll ja von den immanenten Kriterien des Kritisierten ausgehen. (Adorno selbst macht ein paar Zeilen weiter gleich eine Ausnahme: „Proust, den keiner leicht einen Banausen nennen wird und dessen Pedanterie nichts ist als ein Aspekt seiner großartigen mikrologischen Kraft ...)“ „Die letzten Tage der Menschheit“ sind auch „Die letzten Tage der Sprache“. Es wäre auf jeden Fall lächerlich, die Stoßrichtung und Darstellungsweise des Gesamtgefüges zu ignorieren und die Ausdrucksweisen der krausschen Protagonisten zu kritisieren. Als erstes könnte (versuchsweise) festgestellt werden: Sprachverhalten und Redensarten, wie sie in „Die Freuden der Jagd“ durchdekliniert und bloßgestellt werden - daß sie Haltungen wiederspiegeln, versteht sich, wurde aber im Vorfeld naiv vereinfacht-, verdienen nicht den Umgang mit Satzzeichen, um den es Adorno in seinem Aufsatz geht. ,Wie man mit dem Hammer literarisch vorgeht‘, sei in diesen Zusammenhängen viel eher angebracht. Ich will aber den Aufsatz als einen der Hintergründe heranziehen (und damit gleich zu seiner Lektüre einladen), von dem aus eine Perspektive auf das Buch Schlotmanns und seine Eigenheiten gewonnen werden kann. Zu den Provokationen dieses Buches scheint es auf jeden Fall zu gehören, mit den Satzzeichen zu beginnen. "Denn die Anforderungen der Regeln der Interpunktion und des subjektiven Bedürfnisses von Logik und Ausdruck lassen sich nicht vereinen: in den Satzzeichen geht der Wechsel, den der Schreibende auf die Sprache zieht, zu Protest. Weder kann er den vielfach starren und groben Regeln sich anvertrauen, noch kann er sie ignorieren, wenn er nicht einer Art Eigenkleidung verfallen und durch die Pointierung des Unscheinbaren - und Unscheinbarkeit ist das Lebenselement der Interpunktion - deren Wesen verletzen will." Hier läßt sich im Sinne einer Dialektik schon ahnen, daß es auch eine komplementäre Verhaltensweise geben kann, die den Gegenständen, die sie aufs Korn nimmt, gerecht wird, und sei es, daß die Verletzungen, um die es geht, sich im Satzbau und Textgefüge widerspiegeln.
lewi - 13. Okt, 12:48
stabigabi1 - 13. Okt, 20:41
und Roussel
Raymond Roussels Werk wird wohl das klassische Beispiel für die Matjoschka-Digression sein, jenseits von gutem und schlechten Stil. Das ist gewissermaßen Leistungssport, nicht Eistanz.
Oder, ist es so einfach? Vielleicht ist der bloße Vergleich mit dem Eistanz besser, denn Roussel ist ja nicht ein Quantitativer, dem Genauigkeit allein zählt, sondern seine detaillierten wahren Aussagen über die Welt - denn als solche, die die metaphorische Beziehung so spielerisch und maßvoll verknüpft wie der Klöppelfaden die Gesprächsthemen der Klöpplerinnen, erscheinen die Einschübe mehr als alles sonst - haben eine gewisse poetische Handschrift, ein Verhältnismaß, einen schwer zu beschreibenden aber immer erkennbaren physiognomischen Zug. (Physiognomisch sage ich deshalb, weil in der Betrachtung des Gesichts das Empfinden für Geometrie am reichsten in die menschliche Intuition eingesickert zu sein scheint.) Das Dekorative entsteht vielleicht durch die Stärke dieses Maßes gegenüber anderen Beweggründen. Ein Zwang, bestimmte Verhältnisse einzuhalten, fesselt einen Menschen an sich selbst: Er lässt sich ungern über ein bestimmtes Maß hinaus stören; er gerät, wenn er in der Pflege seiner ebenmäßigen Verhältnisse zu lange unterbrochen wird, in Not. Es erinnert mich - wobei das heikel erscheint zu sagen, weil die konstatierte Geisteskrankheit ein billiges Verbindungsglied ist - an Bilder von Takanori Herai, eines japanischen Autisten, der die Schriftzeichen in einem eigenen System, Maß oder einfach in einer Sichtweise so verzerrt, dass sie architektonisch-rhythmisch wie Spinnweben den Raum erfüllen.
Oder, ist es so einfach? Vielleicht ist der bloße Vergleich mit dem Eistanz besser, denn Roussel ist ja nicht ein Quantitativer, dem Genauigkeit allein zählt, sondern seine detaillierten wahren Aussagen über die Welt - denn als solche, die die metaphorische Beziehung so spielerisch und maßvoll verknüpft wie der Klöppelfaden die Gesprächsthemen der Klöpplerinnen, erscheinen die Einschübe mehr als alles sonst - haben eine gewisse poetische Handschrift, ein Verhältnismaß, einen schwer zu beschreibenden aber immer erkennbaren physiognomischen Zug. (Physiognomisch sage ich deshalb, weil in der Betrachtung des Gesichts das Empfinden für Geometrie am reichsten in die menschliche Intuition eingesickert zu sein scheint.) Das Dekorative entsteht vielleicht durch die Stärke dieses Maßes gegenüber anderen Beweggründen. Ein Zwang, bestimmte Verhältnisse einzuhalten, fesselt einen Menschen an sich selbst: Er lässt sich ungern über ein bestimmtes Maß hinaus stören; er gerät, wenn er in der Pflege seiner ebenmäßigen Verhältnisse zu lange unterbrochen wird, in Not. Es erinnert mich - wobei das heikel erscheint zu sagen, weil die konstatierte Geisteskrankheit ein billiges Verbindungsglied ist - an Bilder von Takanori Herai, eines japanischen Autisten, der die Schriftzeichen in einem eigenen System, Maß oder einfach in einer Sichtweise so verzerrt, dass sie architektonisch-rhythmisch wie Spinnweben den Raum erfüllen.
lewi - 16. Okt, 16:33
Alle Hagebutten?
Jede einzelne? In jedem Reifestadium? Der Schummel (Schimmel) im Sprachwechsel beginnt schon mit dem weitgehenden Unterschlagen der Zeitachse. Die Tatsache, daß es ein Verhältnis gibt, berechtigt zur Annahme, daß sich nicht viel ändern wird und ein Großteil des Systems die eigenen Bedingungen reflektiert, wieviel es von der Welt - wo immer die ist: in China, auf der Buchmesse, im Hirn oder im Kräutergarten - auch hineinläßt. Sophistischer Ausweg aus dem Dilemma: die Sprache ist Teil der Welt.
stabigabi2 - 17. Okt, 23:04
Das ist nun aber weder sophistisch noch Ausweg (solang es nicht als Ausweg deklariert wird, dann ist es tatsächlich beides), sondern eine weiter zu bedenkende Ebene.
Zuvor aber wüsst ich gern, was an der Metapher (die mit Begleitschwärmen aufzutreten scheint) des Wechsels nun genau was ist. Wer ist Schuldner, wer Nehmer, was der Wertgegenstand (Sprache?) genau und wie kann man da überhaupt ziehen? Das scheint mir eher schick gesprochen ("zu Protest geht"), als kohärent.
Der Protest z.B. ist doch überall anwesend, oder?
Zuvor aber wüsst ich gern, was an der Metapher (die mit Begleitschwärmen aufzutreten scheint) des Wechsels nun genau was ist. Wer ist Schuldner, wer Nehmer, was der Wertgegenstand (Sprache?) genau und wie kann man da überhaupt ziehen? Das scheint mir eher schick gesprochen ("zu Protest geht"), als kohärent.
Der Protest z.B. ist doch überall anwesend, oder?
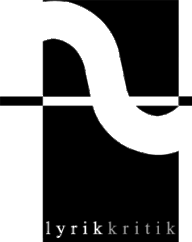
Zeitenwechsel
Hiezu habe ich ein paar Fragen.
1. Muss man nicht nach einem Doppelpunkt das erste Wort groß schreiben, sofern es sich beim Satz nach ihm um einen vollständigen Hauptsatz handelt?
2. Ich verstehe es nicht.
Der Versuch, mich zu informieren, wie man über Wechsel spricht, ließ mich mich schnell fühlen wie ein Mütterchen am Bankschalter.
"In dem Fall, dass ein Wechsel notleidend wird, sollte innerhalb von zwei Werktagen Wechselprotest (bei einem Notar) erhoben werden. Der häufigste Protestgrund dürfte wohl mangels Zahlung sein. Daneben kann aber auch wegen Nichtannahme eines gezogenen Wechsels protestiert werden."
I hob die Bettn bezogen und man hots mir donn ein Schein geben do stehts Wechsel drauf, oper i wüll mei Geld, es worn zwei Werktage wos i gorbeitet hop Bettn wechseln und der Bezogene des is für mich a Matratze wons mi frogn oper mi frogt jo keiner...
Ich nehme den Kredit aufs Korn auf, würde ich gerne weiter den falschen Schuldner spielen, verschusselt blutige Ernte versprechen. Ich nehme den Kredit aufs Korn auf, wenn ich zum Leser spreche wie unter Ehrenmännern, die das Geldgeschäft verstehen.
Heißt es, der Schreibende verlangt von der Sprache etwas, was er nur aufgrund einer Täuschung glaubt, verlangen zu dürfen? Er hat diese Überzeugung übernommen und konnte also gar nicht selbst beurteilen, ob sie stimmt oder nicht?
Heißt es, dass in der unmöglich zu erzielenden Richtigkeit der Grammatik wie in der unmöglich zu erreichenden Gerechtigkeit der Gesetze ungelenke Akzente durchschimmern?
"I vorsteh den Zettl nicht, oper wenn sdu mein Auto wegnehmen, schlog i di zomm."
Ungedeckt
Der Verdacht scheint mir wie ein Luftballon in Fischli und Weiss' Der Lauf der Welt, schwillt an, schwillt an, bis die Feder umspringt: Denn der Verdacht, die Verdächtigkeit ist graduell, doch die Konsequenzen daraus sind dual.
Das bedeutet so sehr eine Gnade, so sehr es eine Schrecklichkeit bedeuten kann, wenn man Pech hat.
Blickt man als Esel ins Buch, streckt sich mithin eine Hand heraus und setzt einem eine Brille auf, an guten Tagen. An schlechten Tagen blickt man als Professor ins Buch, und eine Hand kommt heraus und gibt einem Watschen, dass einem die Brille von der Nase fällt, bis man das Buch wieder zuschlägt.
Da aber die Sprache als Wechsel nicht von Besitz, sondern von der Welt gedeckt wäre, - so träten wir plötzlich von einem Allgemeinen in ein persönlich-verbindliches Verhältnis zur Welt, wenn wir auf ihre Hagebutten einen Wechsel ausstellen.